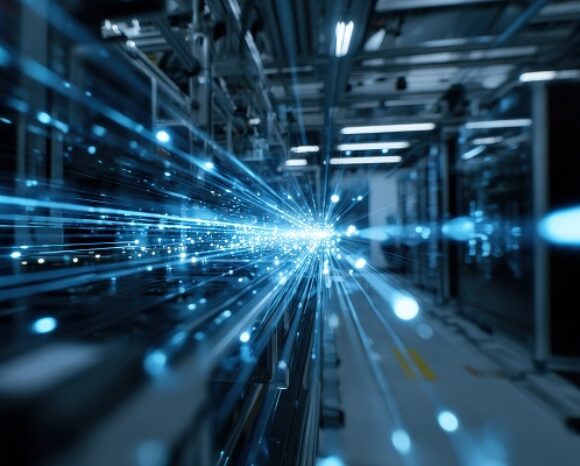Zwischen Effizienz und Grundrechten:: Datenschutz im Zeichen des Bürokratieabbaus
Wie lässt sich Verwaltung modernisieren, ohne den Datenschutz auszuhöhlen? Diese Frage prägte den BvD-Behördentag 2025 in München. Fachleute aus Verwaltung, Aufsichtsbehörden und Politik diskutierten über den Spagat zwischen Entbürokratisierung, Datenschutz-Grundverordnung und der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung – und suchten nach praktikablen Lösungen für eine moderne, rechtskonforme Verwaltung.

Im Mittelpunkt des BvD-Behördentags stand die Frage, wie sich Bürokratieabbau mit dem Schutz von Grundrechten vereinbaren lässt. Prof. Dr. Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz, rückte in seinem Eröffnungsvortrag den Begriff der Bürokratie selbst ins Zentrum – und warnte vor einem rein quantitativen Verständnis.
Bürokratieabbau braucht Qualität, nicht Quantität
„Die Absenkung der Regelungsdichte allein führt nicht zu einem Bürokratieabbau“, betonte Petri. Vielmehr komme es auf die Qualität der Regelungen an. Datenschutz-Dokumentationspflichten seien kein Selbstzweck, sondern notwendige Voraussetzung für gelebten Grundrechtsschutz.
Petri kritisierte die einseitige Fixierung auf sogenannte Erfüllungsaufwände, die vom Nationalen Normenkontrollrat zur Bewertung von Bürokratiekosten herangezogen werden. Der gesellschaftliche Nutzen – etwa der Schutz personenbezogener Daten – lasse sich dagegen kaum beziffern. Dadurch entstehe, so Petri, eine gefährliche Schieflage in der öffentlichen Debatte.
KI-Verordnung: Aufsicht als Kernfrage
Ein zentrales Thema war auch die Umsetzung der europäischen KI-Verordnung und das dazugehörige nationale Durchführungsgesetz, das derzeit im Entwurf vorliegt. Während der Gesetzgeber den Entwurf als „bürokratiearm“ bezeichnet, mahnte Petri zur Vorsicht: Gerade im öffentlichen Sektor, wo Hochrisiko-KI-Systeme eingesetzt würden, müsse die Aufsicht bei den Datenschutzbehörden liegen.
Diese verfügten über die notwendige Erfahrung im Grundrechtsschutz und könnten den Einsatz künstlicher Intelligenz im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung kontrollieren. Petri warnte zudem vor verfassungsrechtlichen Problemen, sollte künftig das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) etwa eine Landespolizei beaufsichtigen. Ein solcher Eingriff in föderale Zuständigkeiten sei rechtlich fragwürdig.
Die Diskussion zeigt, dass die Umsetzung der KI-Verordnung weit mehr ist als eine technische Frage. Sie berührt das Grundverständnis von Aufsicht, Verantwortung und der verfassungsmäßigen Gewaltenteilung.
Nationale Spielräume bleiben eng
Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die rechtlichen Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung europäischen Rechts. In der öffentlichen Wahrnehmung, so Petri, herrsche häufig der Eindruck, deutsche Behörden handelten zu zurückhaltend oder zu formalistisch. Tatsächlich aber seien die Spielräume deutlich enger, als vielfach angenommen.
In Deutschland reicht eine bloße Aufgabenübertragung nicht aus, um eine Befugnis zur Datenverarbeitung zu schaffen – anders etwa als in Frankreich. Zudem setze das europäische Recht selbst enge Grenzen. Der Beschluss, die Datenschutz-Grundverordnung als Verordnung und nicht als Richtlinie zu erlassen, habe die nationale Flexibilität stark eingeschränkt. Damit sei die Balance zwischen europäischer Einheitlichkeit und nationaler Anpassungsfähigkeit eine dauerhafte Herausforderung.
Praxisfragen zwischen Verwaltung und Datenschutz
Neben den Grundsatzfragen zum Verhältnis von Effizienz und Datenschutz standen praxisrelevante Themen im Fokus des BvD-Behördentags. Diskutiert wurden aktuelle Fragen zu Akteneinsicht und Informationsfreiheit, der geplante Europäische Gesundheitsdatenraum, der Einsatz von Microsoft 365 in öffentlichen Stellen sowie neue Entwicklungen im KI-Recht.
Diese Themen zeigen: Datenschutz ist längst kein reines Aufsichtsthema mehr, sondern integraler Bestandteil von Verwaltungsmodernisierung. Die Fähigkeit, Daten rechtskonform zu nutzen, wird zunehmend zum Standortfaktor für Verwaltungen – und damit zum Gradmesser digitaler Souveränität.
Datenschutz als Grundlage moderner Verwaltung
Der Behördentag, eine gemeinsame Veranstaltung des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V., des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg und des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz, machte deutlich: Datenschutz und Bürokratieabbau sind keine Gegensätze, sondern Teil eines Balanceakts zwischen Effizienz und Grundrechten. Der Veranstaltung ging die zweitägige BvD-Herbstkonferenz 2025 voraus, die unter dem Motto „Erfolgreiche Datennutzung: Vertrauen durch Datenschutz“ rund 250 Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zusammenbrachte.
Die zentrale Erkenntnis aus München: Eine moderne Verwaltung braucht klare Regeln – aber sie braucht auch Vertrauen. Datenschutz ist kein Hindernis für Digitalisierung, sondern ihre Voraussetzung. Wer Bürokratie abbauen will, darf nicht die Kontrolle abbauen.

Prof. Dr. Thomas Petri bei seinem Vortrag auf dem BvD-Behördentag 2025 in München.